Was nach der analogen Revolution geschah – Leseprobe
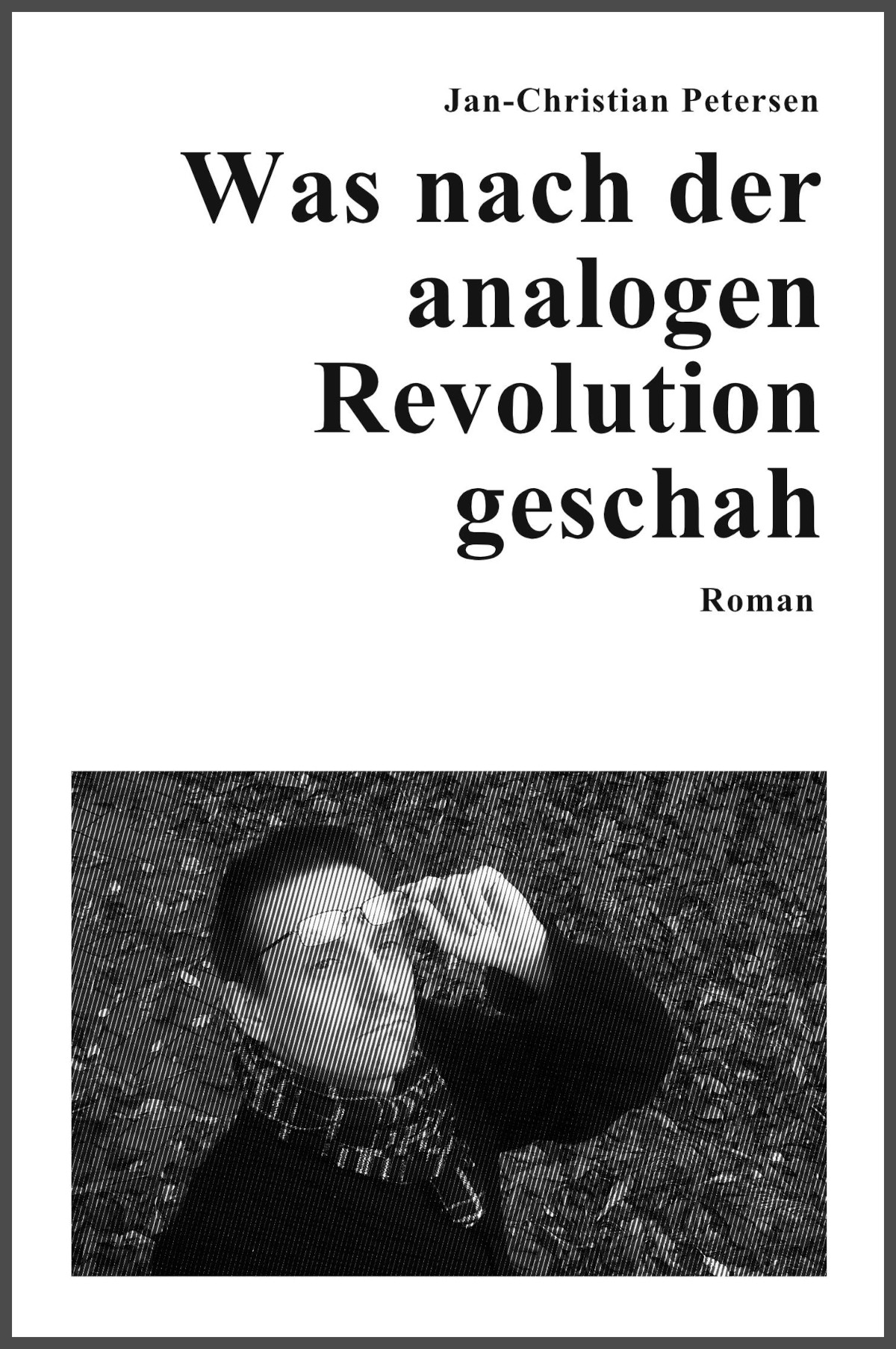
Februar 2024 | Eine schwarzhumorige Endzeit-Dystopie der Kultur mit vielen unliebsamen Typen und sprachlichen Eigenheiten. Der Roman (170 Seiten, Softcover, 2. Auflage) spielt im ländlichen Schleswig-Holstein und in Berlin. Für 14 Euro plus Versand erhalten Sie das Buch über mein Bestellformular oder per E-Mail.
Hier lese ich einen Auszug (Kapitel 6) auf YouTube.
Das Buch handelt von Dr. Achim Strehlitz, der sich aus Unsicherheit in immer mehr Probleme hineinlügt. Um seine so entstandene Beziehung zu retten, muss er das Lebenswerk eines Schundromanschreibers in das Literaturarchiv seiner Akademie aufnehmen. Dabei ist er auf ein vordigitales Zeitalter und auf den Stumpfsinn einer nunmehr von der Kultur abgeschnittenen Bevölkerung zurückgeworfen.
Kurzauszug (Kapitel 1)
„Das Ende“, erkläre ich, „hatte man sich immer ganz anders vorgestellt. Klimawandel, Weltkrieg, nukleare Katastrophe oder was dergleichen – eine Apokalypse eben wie sie im Buche steht, etwas Großes halt.“ Ich blase einen Kringel Rauch ins Separee, der sogleich verfliegt. Sie sucht noch immer zwischen den Klamotten, die am Boden liegen. „Aber dann“, führ ich weiter aus, „was war das für ein lächerlicher Vorgang: ein Anachronismus. Wir sind buchstäblich aus der Zeit gefallen, meine Liebe. Buchstäblich sind wir aus der Zeit herausgefallen. Und das ist alles nur passiert, weil man meinte, die Weltzeit wieder mit der Ekliptik abgleichen zu müssen, und zwar durch das Hochladen einer einzigen Schaltsekunde – eine einzige Schaltsekunde in das Internet und in alle Rechner dieser Welt.“
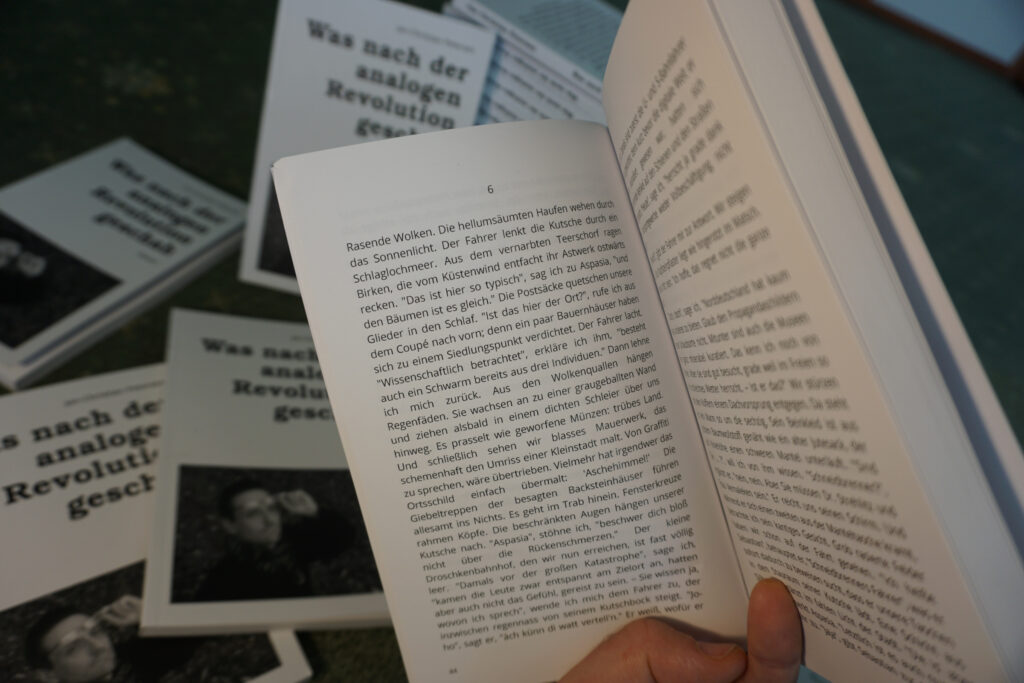


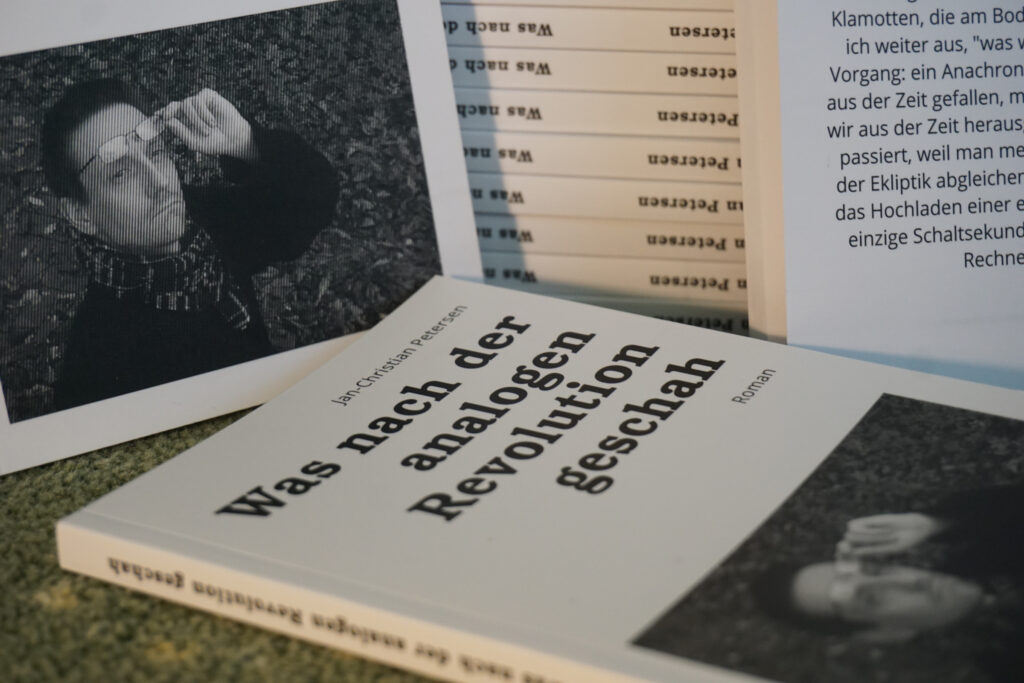
Kleine Leseprobe – Kapitel 1 (Auszug)
„Strehlitz heiß ich, Achim Strehlitz“, brülle ich in ihr Gesicht. Ich glaub ja nicht mal, dass sie das wirklich wissen will, doch sie hatte mich gefragt. Die Bigband schmettert Jazz, epileptisch geradezu. Ein Jitterbug und alles fliegt. Sie schreit irgendwas. Ich gröl zurück: „Du bist doch sicherlich noch keine 18!“
„Im Pass steht’s aber anders“, lügt sie. Saxophone tremolieren, schrillen. Was mach ich nur? Was mach ich nur? – Alkohol und Zigaretten tun ihr Übriges, während ich versuch, dagegen anzudenken. Nach außen rausch ich wie die anderen. Gestanztes Licht. „Guck mal“, rufe ich ihr zu, „da oben sitzen sicher zehn bis zwölf Beleuchter.“ Sie tanzt. Ich deute ins Gestänge über dem Parkett: „Die haben sogar einen, der stroboskopisch die Lamellen vor ’nem Fackelkasten klappt – oder ob das noch elektrisch is‘ ?“
Wie lächerlich. Ich könnte ja ihr Vater sein. (Interessieren tut sie das alles nicht.) Und dann fang ich ausgerechnet von der Epoche an, die sie wahrscheinlich nur noch aus Geschichten kennt. Strom ist ja buchstäblich so was von out. Die manuelle Beherrschung der Beleuchtung gleicht da einem Kunstwerk, aber Verständnis hat sie dafür nicht. Eine Partitur der Lichter: jede Lampe wie ein Instrument in handwerklich perfekter Choreographie. Sie ist halt damit aufgewachsen, schätzt in der Gewohnheit nicht, was es bedeutet, einen solchen Aufwand zu betreiben. Dabei müsste sie es wissen – grade sie bei ihrem Job.
Gut sechzig Körper zappeln im akustischen Vier-Fünftel. Was wir ‚tanzen‘ nennen, treibt mich an den Rand vom Holzparkett. Sie nimmt das als Offerte wahr. Ja, offensichtlich meint sie, dass dies das Zeichen sei, sich nun in einen der Privatbereiche zu verdrücken. Sie folgt mir auf dem Fuße – langsam, denn um uns stürzt die Menschenwand. Und vor mir in dem Schummerleuchten, das von den Tischen in den Barraum glimmt, steht Neupert – ausgerechnet Neupert. Die Kerzen flackern ihm in sein Gesicht, beschneiden die Konturen seiner dicklichen Gestalt. Er brüllt mich an, ich solle „so einen!“ trinken, dabei schnippt er mit dem Finger an sein Cocktailglas. Die Kollegen haben ihn nur deshalb mitgenommen, weil er das System entwickelt hat, das sie benutzt haben, um diskret zu dem Event hier einzuladen. Simpel, dennoch nicht genial. Es hatte damals alles damit angefangen, dass Neupert eine Nachricht auf dem Schreibtisch eines Mitarbeiters hinterlassen hat. Belangloses selbstverständlich. Zwei Wochen später hatten sie dann alle kleine Zettelkästen auf den Tischen. Wie praktisch das doch sei. Dabei dient inzwischen nur noch jede zehnte Nachricht auch der Arbeit. Die Übrigen behandeln Nonsens und Gelaber, woraus auch die Idee zu diesem ‚Ausflug‘ hier nach Amsterdam entstanden ist.
Neupert hebt sein Glas noch höher, deutet mit gespitztem Finger auf dasselbe, während er mit seinem Mund dazu gebärdisch stumm die Worte mimt. Ich schaue weg, tue so, als ob ich ihn nicht seh, und dreh mich auf dem Absatz um. Da steht sie wieder vor mir (sehr viel nackte Haut) und hinter ihr die Biomasse, die sich in den Soundbrei rührt. „Weißt du“, brülle ich, „privat bin ich ja ganz anders.“
„Aha.“
Interessieren tut sie das noch immer nicht. Und ich mach mich wieder lächerlich, denn privater als an diesem Ort kann man wohl kaum sein. Ich lächel, tanze. Mein ganzer Körper lügt. Ich muss, wenn ich den Kollegen gegenüber nicht verdächtig scheinen will. Letztlich haben wir eine Komplizenschaft zu teilen, was die Verwendung jener Mittel betrifft, welche die Akademie hier in unsere Weiterbildung investiert. „Meine Abteilung“, versuche ich es mit der Wahrheit, „keilt den gesamten Achilleus Tatios in Ton!“ Da macht sie große Augen. „Jedenfalls beeindruckt man wieder mit Schrift, wa‘ !?“, füg ich noch hinzu. Und dann wird mir wieder klar, wie jung sie ist. Sie strahlt: „Komm, ich zeig dir was!“
Hinweie zum Urheberrecht: Das Buch von Jan-Christian Petersen „Was nach der analogen Revolution geschah“ erscheint nur gedruckt. Der hier gegebene Buchauszug erscheint nur hier auf www.j-c-p.eu. Vervielfältigungen – insbesondere Digitalisierungen und eine Verbreitung der Inhalte (auch auszugsweise) in gedruckter, sprachlich vertonter, digitaler oder in anderen Formen – sind nicht zulässig.
